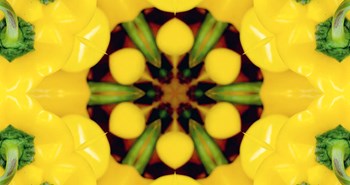Valentina Wetter, CEO des gleichnamigen Familienunternehmens spezialisiert auf industrielle Bau- und Immobilienprojekte mit 160 Mitarbeitenden in der dritten Generation, formulierte es klar: «Lebensphasen zählen, nicht Geburtsjahre.» Ein dreissigjähriger Vater habe andere Bedürfnisse als ein gleichaltriger Single am Beginn einer Führungskarriere. Ebenso könne eine sechzigjährige Führungskraft ähnliche Anforderungen an Flexibilität haben wie ein junger Elternteil. Entscheidend sei, welche Lebenssituation vorliege und welche Werte im Vordergrund stünden.
Lernen als Brücke zwischen den Generationen
Mehrfach wurde betont, dass Lernen eine Schlüsselkompetenz ist, um mit der Geschwindigkeit des Wandels Schritt zu halten. Anja Förster, Gründerin von Rebels at Work, stellte in ihrer Keynote die prägnante Frage: «Lerne ich eigentlich so schnell, wie die Welt sich da draussen verändert?» Unternehmen, die starr an alten Planungsmechanismen festhielten, gingen ihrer Ansicht nach den Weg der minimalen Agilität. Erfolgreicher seien jene, die bereit seien, mutig zu experimentieren, Fehler zuzulassen und im Handeln zu lernen und zu justieren.
Auch Höpflinger sah das Lernen als verbindendes Element. Wissensvermittlung verlaufe heute oft in beide Richtungen. Während ältere Mitarbeitende ihre Erfahrung einbringen könnten, zeige sich in der Praxis, dass Jüngere ihre Vorgesetzten etwa bei digitalen Themen unterstützten. «Faktisch läuft der Lernprozess oft umgekehrt: Die Enkelkinder erklären den Grosseltern, wie ein Smartphone funktioniert», sagte er. Entscheidend sei die Bereitschaft, diese Wechselwirkung zu akzeptieren und zu nutzen.
Valentina Wetter berichtete, wie in ihrem Unternehmen Coaching am Arbeitsplatz eingesetzt werde, damit erfahrene Projektleiter ihr Wissen gezielt an Jüngere weitergeben. Gleichzeitig würden «lessons learned» dokumentiert und teamübergreifende Projekte initiiert, die den Austausch förderten. Für sie sei das ein Beispiel dafür, dass Lernen nicht von formellen Strukturen abhänge, sondern von einer Kultur, die Austausch ermögliche.
Diversität als Innovationsfaktor
Die Auseinandersetzung mit Diversität ging weit über die Altersfrage hinaus. Förster warnte eindringlich vor Homogenität: «Homogenität ist der grösste Killer von Innovationen.» Unterschiedliche Perspektiven erzeugten Reibung, doch gerade darin liege der Mehrwert. Viele Führungskräfte scheuten diese Reibung, weil sie unbequem sei. Das Ergebnis seien «schwarmdumme Teams», die schlechtere Lösungen und weniger Innovationen hervorbrächten.