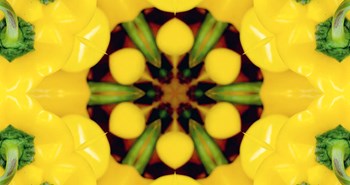Sarah Genner, mit dem Whitepaper «New Work Schweiz» haben Sie eine ambitionierte Netzwerk-Initiative lanciert, womit Sie den Werkplatz Schweiz inspirieren wollen. Welche Rolle spielt dabei HR?
Ja, das Whitepaper verfolgt tatsächlich ein ambitioniertes Ziel, die Schweiz zu inspirieren, möglichst attraktive Arbeitsplätze zu schaffen. Infolge des digitalen Wandels hat sich viel verändert. Fragen wie Hybrid Work und Homeoffice haben sich durch die Pandemie zusätzlich akzentuiert. Das Rad lässt sich nicht mehr zurückdrehen – auch wenn das viele Führungskräfte gerne hätten. Diese sind heute wie nie gefordert, für die Mitarbeitenden eine gute Balance zu finden zwischen der Förderung von flexiblen Arbeitsbedingungen und verbindender Zugehörigkeit. HR ist als Zentralstelle für Personalfragen ein wichtiger Treiber, um sich entsprechend für die Zufriedenheit der Mitarbeitenden einzusetzen, und eigentlich prädestiniert, in New-Work-Themen eine führende Rolle zu spielen. Allerdings immer in Kooperation mit anderen Abteilungen.
Der Werkplatz Schweiz umfasst Unternehmen mit einer Vielfalt an Firmenkulturen und HR-Strukturen sowie komplett unterschiedlichem Digitalisierungsgrad. Wie wollen Sie dieser Heterogenität gerecht werden?
Das ist natürlich die Gretchenfrage. Natürlich ist New Work im Moment sehr stark auf die Bürowelt fokussiert. Das ist zwar nur ein Teil der Arbeitswelt, in der Schweiz aber sehr relevant. Dennoch geht New Work deutlich weiter. New Work richtet den Fokus ganz generell auf möglichst gute Zusammenarbeit im digitalen Zeitalter. Dabei spielt es gar nicht so eine Rolle, ob die Arbeitsplätze vor Ort, remote oder hybrid sind. Es geht darum, eine möglichst gute Zusammenarbeit und eine möglichst hohe Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen sicherzustellen, um die besten Talente anzuziehen und zu halten.
Was entgegnen Sie Kritikern, die den Begriff «New Work» nur noch für ein wohlklingendes Schlagwort halten, womit sich allerlei Beratungsleistungen verkaufen lassen?
Es stimmt, dass New Work auch eine Projektionsfläche ist. Den Begriff muss man erstmal mit Inhalt füllen, damit er nicht zu einer Worthülse verkommt. Ich nutze ihn im Kontext der digitalen Transformation, die flexibles, mobiles Arbeiten unterwegs und im Homeoffice erst richtig ermöglicht hat. Diese technologische Entwicklung stellt eine Zäsur dar und ging der Pandemie voraus, die einen unumkehrbaren Paradigmenwechsel eingeläutet hat: Unsere Art, mobil und flexibel zu arbeiten, ist zu einem Standard geworden und wird in dem aktuellen Arbeitnehmermarkt von vielen Mitarbeiterinnen inzwischen wie selbstverständlich eingefordert. Wer zufriedene Mitarbeitende möchte, muss sich daher mit hybrider Zusammenarbeit auseinandersetzen.