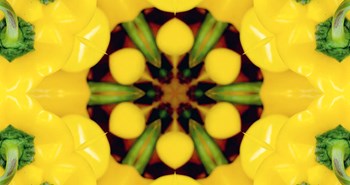Deckungsgrad: Unterdeckung macht Arbeitgeber unattraktiv
Deckungsgrade lassen abschätzen, wie hoch das Risiko einer künftigen Sanierung ausfallen könnte, an der aktive Versicherte beteiligt werden, nicht aber die garantierten Leistungen der Pensionierten. Ausgewiesen wird meist der sogenannte technische Deckungsgrad. Er zeigt das Verhältnis zwischen Nettovermögen und versicherungstechnisch bewerteten Verpflichtungen, diskontiert mit dem technischen Zins, von dem die Aussagekraft des Deckungsgrads daher abhängt – je tiefer dieser gewählt ist, umso höher sind die Verpflichtungen bewertet und umso tiefer ist der Deckungsgrad der Pensionskasse. Bei Werten unter 100% gerät eine Pensionskasse in Unterdeckung: Die Verpflichtungen sind dann nicht vollständig mit dem vorhandenen Vermögen gedeckt. Deckungsgrade über 100% gelten umgekehrt als Zeichen von Stabilität und Sicherheit.
Verzinsung: Mindestzins und mehr
Nicht zu verwechseln ist der technische Zins mit jenem Satz, zu dem die Altersguthaben tatsächlich verzinst werden. Diese Verzinsung stammt von den Erträgen, mit denen das Guthaben an den Kapitalmärkten angelegt wurde, und bestimmt, wie stark das Altersguthaben bis zur Pensionierung wächst. Bei der Verzinsung ist zu unterscheiden zwischen dem BVG-Mindestzinssatz, der vom Bundesrat jährlich unter Berücksichtigung der Renditeentwicklung von Wertanlagen wie Bundesobligationen, Anleihen, Aktien und Liegenschaften festgelegt wird und nur für die Verzinsung des BVG-Mindestguthabens massgebend ist, und dem Zinssatz für die überobligatorischen Gelder. Im überobligatorischen Bereich der 2. Säule bestimmt das oberste Organ über die Verzinsung der Altersguthaben. Viele Vorsorgeeinrichtungen wenden eine umhüllende Verzinsung an: Der vom obersten Organ festgelegte Zinssatz gilt für das gesamte Altersguthaben.
Rendite: Diverse Wege führen zum Ertrag
Den Ertrag des an den Finanz- und Immobilienmärkten investierten Kapitals bezeichnet man als Rendite. Sie beruht einerseits auf laufenden Erträgen wie Zinsen auf Obligationen und Dividenden auf Aktien sowie andererseits auf den Kursgewinnen der Wertpapiere, in die das Vermögen der Versicherten investiert wurde. Wenn zur Rendite noch das Risiko miteinbezogen wird, erhält man die Performance. Sie berücksichtigt, dass höher rentierende Anlageklassen meist auch mit einem höheren Risiko verbunden sind.
Verwaltungskosten: Digitalisierung fördert Einsparungen
Die gesetzlichen Transparenzvorschriften verlangen, dass die Verwaltungskosten verursachergerecht in der Jahresrechnung ausgewiesen werden. Die Gesamtkosten der Vermögensbewirtschaftung werden separat in der Analyse der Kapitalanlagen dargestellt.
Die Verwaltungskosten der Pensionskassen dürfen nicht mit jenen der AHV verglichen werden. Die Administrationsarbeiten in der beruflichen Vorsorge sind wesentlich umfangreicher. Insbesondere Leistungsfallabwicklungen sowie Vermögenstransfers bei Ein- und Austritten oder Kapitalbezügen sind aufwendig in der Verarbeitung. Elektronische Kundenportale haben hier Einsparungen ermöglicht, ebenso Fusionen sowie Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen. Denn je grösser der Bestand an Versicherten ist, umso besser lassen sich die Fixkosten auf die Anzahl Personen verteilen.
Verhältnis von aktiven Versicherten zu Rentenbeziehenden
Das Verhältnis zwischen aktiven Versicherten und Rentenbeziehenden unterscheidet sich stark zwischen Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen, die oft viele jüngere Mitarbeitende aus kleineren Firmen versichern, und öffentlich-rechtlichen Kassen sowie Firmenpensionskassen, die typischerweise einen höheren Anteil von Rentenbeziehenden aufweisen. Das Verhältnis hat einen Einfluss auf die finanzielle Stabilität und Risikofähigkeit. Denn die Beiträge der Aktiven decken laufende Rentenzahlungen.