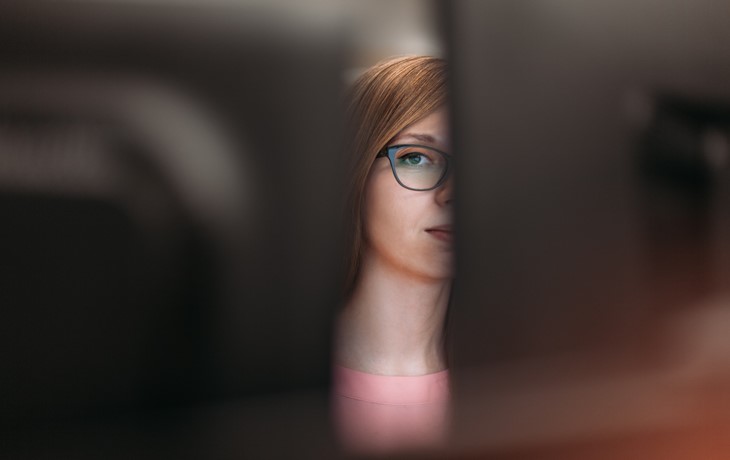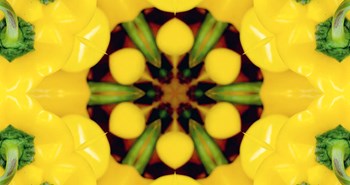Zweckwidrigkeit als Verweigerungsgrund
Für die Verweigerung der Auskunft wird sich die Arbeitgeberin in solchen Fällen meist auf den Einwand der Zweckwidrigkeit berufen. Demnach kann ein Auskunftsgesuch insbesondere dann «offensichtlich unbegründet» und zu verweigern sein, wenn es einen «datenschutzwidrigen Zweck» verfolgt. Im revidierten DSG, das im Jahr 2023 in Kraft getreten ist, ist dieser Einwand ausdrücklich erwähnt.Er ist aber auch Gegenstand einer Rechtsprechung des Bundesgerichts, die auf die Zeit vor Inkrafttreten des revidierten DSG zurückgeht. Schon daraus ergab sich, dass die Berufung auf das Auskunftsrecht zweckwidrig und damit rechtsmissbräuchlich sein kann, wenn es nur als Vorwand dient, die andere Partei auszuforschen, Prozesschancen abzuklären oder mögliche Beweise zu beschaffen (sog. «fishing expedition»).[3]
Konkret ist es nach einer verbreiteten Formel zulässig, die Auskunft mit Verweis auf die Zweckwidrigkeit zu verweigern, wenn «dargelegt werden kann, dass das Gesuch offensichtlich in relevanter Weise einem Zweck dient, der nicht den Datenschutz betrifft». Bei den Zwecken, die den Datenschutz betreffen, ist vor allem an die Geltendmachung der weiteren Datenschutzrechte wie Widerspruchs- oder Berichtigungsrechte zu denken.[4] Keine den Datenschutz betreffende Zwecke sind dagegen «fishing expeditions» mit Blick auf mögliche Geldforderungen oder andere Forderungen gegen die Arbeitgeberin. Für die Prüfung des Gesuchs muss die Arbeitgeberin anhand der konkreten Umstände die effektiv verfolgten Zwecke zu ergründen versuchen. Diese müssen nicht zwingend denjenigen Zwecken entsprechen, auf die sich der Gesuchsteller gegenüber der Arbeitgeberin beruft.
Ergibt die Beurteilung durch die Arbeitgeberin, dass die Auskunft wegen Zweckwidrigkeit des Gesuchs zu verweigern ist, hat sie dies dem Arbeitnehmer mitzuteilen. Die Mitteilung hat in der Regel innert 30 Tagen zu erfolgen. Ist dies nicht möglich, hat sie dem Arbeitnehmer mitzuteilen, wann ihre Mitteilung erfolgen wird.[5] Hält der Arbeitnehmer die Auskunftsverweigerung für unberechtigt, kann er versuchen, sein Auskunftsrecht mittels gerichtlicher Klage durchzusetzen.[6] Hierzu hat der Arbeitnehmer ein Schlichtungsgesuch bei der zuständigen Stelle einzureichen, da als erster Schritt ein Schlichtungsverfahren zu durchlaufen ist.
Weitere mögliche Einwände gegen das Gesuch
Neben der erwähnten Zweckwidrigkeit gibt es weitere Gründe, die zur Verweigerung, zur Einschränkung oder zum Aufschub einer Auskunft berechtigen können. Infrage kommen entsprechende Bestimmungen in anderen Gesetzen, wie sie zum Beispiel für die Berufsgeheimnisse bei Medizinalberufen, Anwälten und Geistlichen statuiert sind, oder überwiegende Interessen Dritter.[7] Zudem kann ein Gesuch auch aus dem Grund zu verweigern sein, dass es offensichtlich querulatorisch ist.[8] Hinsichtlich Umfang der allfälligen Auskunft gilt zudem, dass über «Personendaten als solche» zu informieren ist. Die allfälligen Dokumente, in denen die Personendaten enthalten sind, müssen dagegen nicht zwingend herausgegeben werden.
Wichtig zu bedenken sind die Strafbestimmungen, die das DSG im Zusammenhang mit dem Auskunftsrecht vorsieht. Diese knüpfen an das vorsätzliche Erteilen einer falschen oder unvollständigen Auskunft an.[9] Für die vollständige Verweigerung einer verlangten Auskunft sieht das DSG dagegen keine Strafbarkeit vor. Dies kann bei den handelnden Personen zur Überlegung führen, im Zweifelsfall lieber gar keine als eine unvollständige (oder falsche) Auskunft zu erteilen. Zudem erscheint es aufgrund der Strafbestimmungen nicht ratsam, bei Erteilung einer Auskunft eine Vollständigkeitserklärung oder dergleichen abzugeben. In Auskunftsersuchen wird zwar oft eine solche Erklärung verlangt. Das Gesetz sieht indes keinen Anspruch auf eine solche Erklärung vor.
Take Aways
- Arbeitgebende sollten jedes Auskunftsgesuch nach DSG von Mitarbeitenden individuell prüfen.
- Die Zwecke, die das Gesuch effektiv verfolgt sowie gegebenenfalls weitere Einschränkungsgründe sollen geprüft werden.
- Die Frist für die Auskunft oder die Mitteilung über eine Einschränkung beträgt in der Regel 30 Tage.
- Das DSG enthält eine Strafandrohung für unvollständige oder falsche Auskunft.
- Für eine Vollständigkeitserklärung gibt es keine gesetzliche Grundlage.