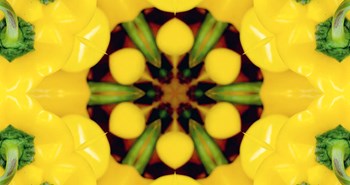In letzter Zeit ist zunehmend von einer gesellschaftlichen Rückwärtsbewegung die Rede. Spüren Sie einen entsprechenden Backlash auch in der Transformation der Arbeitswelt, und was bedeutet ein solcher für die Führung?
Ich beobachte neben Aufbruch auch eine Tendenz hin zum Zumachen aus Angst vor grosser Veränderung. Konservative Diskurse und politische Kräfte, die wenig Kooperation fördern, verstärken den Druck auf Organisationen. Dadurch wächst der Widerspruch zwischen Kennzahlenlogik und der Erwartung an empathische, partizipative Führung. Das Topmanagement fordert Daten und Ergebnisse, zugleich soll mehr Selbstorganisation ermöglicht werden. Dieser Zielkonflikt vergrössert die Belastung insbesondere in der Mitte.
Welche klassischen Führungsaufgaben würden Sie heute neu verteilen?
Ich würde etwa die Mitarbeitenden-Beurteilungen weg von der reinen Führungsverantwortung nehmen. Peers können Leistung oft besser einschätzen als Vorgesetzte. Das jährliche Beurteilungsgespräch, und dann vielleicht noch im engen Korsett von Boni-Systemen, ist für alle frustrierend. Peer-Feedback-Formate wären ehrlicher und motivierender. Auch die Rekrutierung sollte nicht allein bei der Führungskraft liegen. In unserer Genossenschaft führen Teams die Gespräche gemeinsam. Die Führung braucht Freiraum, um strategisch zu denken, die Weiterentwicklung von Menschen zu ermöglichen und Orientierung zu geben. Dazu gehört auch, Wissen weiterzugeben, als Mentor oder Mentorin, statt Weiterbildung vollständig auszulagern.
Welche Rolle kommt HR in einer modernen Organisation zu?
HR sollte näher an den Menschen arbeiten und kulturelle Entwicklungen aktiv mitgestalten. In vielen Unternehmen ist HR noch zu weit weg vom Tagesgeschäft oder nicht gleichberechtigt in der Geschäftsleitung vertreten. Modelle wie HR-Business-Partner funktionieren nur, wenn diese Rolle die Teams wirklich kennt und deren Dynamiken spürt.
Was hilft, Führungskräfte in der heutigen Komplexität zu entlasten?
Erstens: Verantwortung verteilen – mit klaren Rechten und Pflichten. Menschen brauchen Entscheidungsfreiräume, sonst bleiben sie abhängig und passiv. Zweitens: Selbstführung stärken. Nur wer sich selbst führen kann, kann andere führen. Dazu gehört, die eigenen Grenzen und Bedürfnisse zu kennen und regelmässig zu reflektieren. Und drittens: Zeit zum Denken schaffen. Viele Führungskräfte sind nur noch in Feuerwehrübungen unterwegs. Sie brauchen Räume, um Prioritäten zu ordnen und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren.
New Work wird oft als Lösung verkauft, kann aber auch zusätzliche Belastung bringen. Wie sehen Sie das?
Hilfreich sind rollenbasiertes Arbeiten mit klaren Verantwortlichkeiten und Entscheidungskompetenzen sowie eine Kultur von «good enough to start and safe enough to try». Das stärkt den Mut, Neues auszuprobieren, und ermöglicht kontinuierliches Lernen. Überfordern können zu viele Tools und Kommunikationskanäle. Wenn die Informationswege unklar sind, entsteht Chaos statt Entlastung. Trotz aller digitalen Möglichkeiten bleiben persönliche Gespräche unverzichtbar, um Vertrauen und Verbindung zu schaffen.
Zum Schluss: Welche drei Reflexionsräume sollten Führung und HR heute gemeinsam öffnen?
Selbstführung beginnt mit der Bereitschaft, eigene Muster zu reflektieren. Viele Probleme haben ihren Ursprung darin, dass wir an alten Denkweisen festhalten. Wir müssen lernen, loszulassen statt zu kontrollieren – Micromanagement ist selten die Lösung. Führung neu zu denken, bedeutet für mich, Verantwortung gemeinsam zu tragen – nicht weniger, sondern bewusster.
Take Aways
- Führung im mittleren Management ist heute ein Balanceakt zwischen Kennzahlen, Empathie und Selbstorganisation.
- Die besten Fachpersonen sind nicht automatisch gute Führungskräfte – systemische Auswahlfehler müssen korrigiert werden.
- HR sollte näher an die Teams rücken und Verantwortung für kulturelle Entwicklung übernehmen.
- Selbstführung und Reflexion sind zentrale Kompetenzen moderner Führung.
- New Work gelingt nur, wenn Vertrauen, Kommunikation und klare Strukturen zusammenspielen.