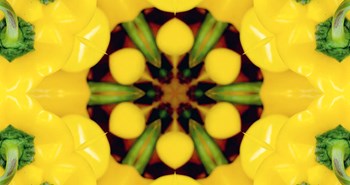Nachfolgende fiktive Beispiele zeigen auf, wie je nach Sachverhalt unterschiedliche Regeln zur Anwendung kommen. Nur eine genaue Analyse aller Faktoren und das Ziehen der richtigen Schlüsse führen zu rechtskonformen Lösungen.
Caroline aus Österreich
Die Schweiz AG ist ein Unternehmen mit Sitz in der Schweiz (CH). Sie besetzt eine vakante Vollzeitstelle mit Caroline, einer Fachspezialistin mit österreichischer Staatsangehörigkeit, die in Österreich (AT) lebt. Auf ihren Wunsch wird als Arbeitsort «Homeoffice» vereinbart.
Es handelt sich um eine gewöhnlich im Ausland ausgeübte Tätigkeit, vorliegend ausgeübt im Wohnsitzstaat. Betroffen sind die Schweiz (Arbeitgebersitz) und Österreich (Wohnsitz, Nationalität). Somit ist das Freizügigkeitsabkommen zwischen der CH und der EU anwendbar, insbesondere die Verordnungen VO 883/2004 und VO 987/ 2009.
Bei Erwerbstätigkeit in nur einem Staat gilt das Erwerbsortsprinzip, das heisst, die sozialversicherungsrechtliche Unterstellung fällt vorliegend nach AT. Die Schweiz AG muss sich in AT als Arbeitgeberin registrieren und Carolines Lohn nach AT-Recht mit den AT-Behörden abrechnen. Die Abrechnungspflicht könnte auch an Caroline abgetreten werden, die Haftung für die korrekte Abrechnung und Bezahlung der Beiträge bleibt jedoch bei der Schweiz AG.
Merke: Bei Unterstellung im Ausland richten sich nicht nur die Beiträge nach fremdem Recht, sondern auch die Leistungen. Es empfiehlt sich, den Arbeitsvertrag daraufhin zu prüfen, ob die versprochenen arbeitsvertraglichen Leistungen von den ausländischen Versicherungen gedeckt werden. Dies betrifft nicht nur kurzfristige Taggelder und Heilungskosten, sondern auch Vorsorgeleistungen für Invalidität, Tod und Alter.
Caroline pendelt
Caroline stellt fest, dass sie durch den fehlenden persönlichen Kontakt vieles nicht mitbekommt. Sie beschliesst daher, sporadisch jeweils für ein paar Tage in den Büros der Schweiz AG zu arbeiten.
Nun handelt es sich nicht mehr um eine gewöhnlich im Ausland ausgeübte, sondern um eine Mehrfachtätigkeit. Das Abkommen mit der EU bestimmt, dass in solchen Fällen die Unterstellung nur in einen Staat fällt, es gilt somit zu koordinieren, in welchen. Es kommt die 25%-Regel zum Tragen: Arbeitet Caroline 25% oder mehr in ihrem Wohnsitzstaat AT, fällt die Unterstellung nach AT, mit denselben Konsequenzen wie oben beschrieben. Die Bemessung der 25% basiert auf dem für die nächsten zwölf Monate geplanten Arbeitsmuster.
Merke: Beträgt die Tätigkeit im Wohnsitzstaat zwischen 25 und 49%, besteht ein Wahlrecht gemäss MFA (Multilateral Framework Agreement). Caroline und die Schweiz AG könnten sich auf eine Unterstellung in der CH einigen oder die Unterstellung in AT belassen. Das Wahlrecht besteht jedoch nur unter Einhaltung bestimmter Voraussetzungen, was in der Verantwortung der Arbeitgeberin liegt. Da Arbeitgebende nicht zwingend über alle notwendigen Informationen verfügen, empfiehlt sich eine regelmässige Überprüfung und Bestätigung durch die Arbeitnehmenden.
Die Schweiz AG will Carolines Lohn nicht im Ausland abrechnen. Sie einigen sich daher auf zwei Tage Homeoffice (entspricht 40%) und vereinbaren den Verbleib im CH-Sozialversicherungssystem. Doch Vorsicht: Folgende Umstände können dazu führen, dass das MFA nicht mehr anwendbar ist:
- Caroline reduziert das Pensum auf vier Tage pro Woche bei gleichbleibender Anzahl Tage im Homeoffice. Problem: Die vier Tage bilden neu das volle Pensum, die zwei Tage Homeoffice ergeben einen Anteil von 50%.
- Caroline nimmt in AT eine Nebenbeschäftigung an. Problem: Das MFA ist nicht anwendbar auf Personen, die neben der Tätigkeit für ihren Schweizer Arbeitgeber noch für einen Arbeitgeber in der EU bzw. in einem EFTA-Staat arbeiten.
- Caroline besucht auch Kunden der Schweiz AG in AT. Problem: Das MFA ist nicht anwendbar auf Personen, die neben Telearbeit im Wohnstaat noch eine andere Tätigkeit in einem EU- bzw. EFTA-Staat ausüben. Das gilt auch für andere Tätigkeiten für die Schweiz AG und im Wohnstaat.
- Caroline absolviert die Nicht-Homeoffice-Tage in der liechtensteinischen Niederlassung der Schweiz AG, da diese näher an ihrem Wohnort liegt. Problem: Das MFA ist nicht anwendbar auf Personen, die nicht im Sitzstaat ihres Arbeitgebers arbeiten. (Zudem ist Liechtenstein kein Mitglied der EU, sodass das Freizügigkeitsabkommen nicht anwendbar ist.)
- AT oder die CH kündigt das MFA. Nicht alle EU-Länder haben das MFA unterzeichnet, und jedes Land hat die Möglichkeit, dieses unabhängig vom Freizügigkeitsabkommen wieder zu kündigen.
Merke: Wäre Caroline UK-Bürgerin, wäre weder das Abkommen mit der EU noch das MFA anwendbar. Dasselbe gilt, wenn Caroline die Staatsangehörigkeit eines EFTA-Staats hat. In solchen Fällen kommt das bilaterale Länderabkommen zum Tragen, vorliegend zwischen der CH und AT. Viele Länderabkommen sind nur für Staatsangehörige der Vertragsstaaten anwendbar und sehen ein Unterstellungssplitting vor, d.h. die Lohnanteile sind jeweils im Staat, in dem die Arbeit geleistet wurde, abzurechnen. Wenn kein Abkommen anwendbar ist, gilt das nationale Recht in beiden Ländern. So kann es auch zu Doppelbelastungen kommen.
Caroline stellt Rechnung als Selbständige
Die Schweiz AG sucht eine kreative Lösung, Caroline die Tätigkeit im Heimatstaat zu ermöglichen, ohne dass sie sich um ausländisches Recht kümmern muss. Caroline soll sich selbständig machen und der Schweiz AG Rechnung stellen.
Die Schweiz AG tut gut daran, die Thematik «Scheinselbstständigkeit» nach AT- und CH-Recht prüfen zu lassen. Die Bedingungen für eine Qualifikation als Selbständigerwerbende sind im Ausland teilweise noch strenger als in der Schweiz. In der Praxis ist es oft so, dass eine Selbständigkeit als Umgehung für die sozialversicherungsrechtliche Unterstellung nicht funktioniert. Insbesondere die Weisungsunterstellung ist ein wunder Punkt. Je tiefgreifender die vermeintliche Auftraggeberin Einfluss nehmen will auf die Art und Weise der Auftragserfüllung, desto grösser ist das Risiko einer Umqualifizierung in ein abhängiges Arbeitsverhältnis. Dasselbe gilt, wenn ein Auftragsverhältnis praktisch die Existenzgrundlage bildet.
Caroline wird über eine Gesellschaft vor Ort beschäftigt
Als letzte Variante überlegt die Schweiz AG, Caroline über ein lokales Unternehmen in AT anzustellen, das Carolines Lohn abrechnet und der Schweiz AG den Lohn- und Sozialversicherungsaufwand in Rechnung stellt. Das kann eine Gruppengesellschaft sein oder eine unabhängige Drittfirma. Es gibt auch sogenannte EOR (Employer of Record) oder PEO (Professional Employment Organization), die genau das als Geschäftsmodell anbieten. Dabei werden je nach Anbieter die Weisungsrechte aufgeteilt.
Auch diese Lösungen bergen Risiken. Je nach Land wird unterschiedlich definiert und geregelt, was als Personalverleih gilt. In der CH gelten Kriterien für eine Bewilligungspflicht, um Personal verleihen zu dürfen, geknüpft an die Einhaltung diverser Vorschriften. Personalverleih aus dem Ausland in die Schweiz ist verboten.
Merke: Die sozialversicherungsrechtlich einfachste Lösung ist, dass Caroline in die schöne Schweiz zieht.
Günter im Verwaltungsrat
Die Schweiz AG möchte mit ihren Produkten Fuss fassen in Deutschland (DE). Sie wählt Günter in den Verwaltungsrat (VR). Die Schweiz AG verspricht sich viel davon, denn Günter lebt in DE, hat ein riesiges Netzwerk und kennt den Markt.
Für Personen in geschäftsleitender Funktion gelten besondere Regelungen für die sozialversicherungsrechtliche Unterstellung. VR-Mitglieder haben per Gesetz nicht delegierbare geschäftsführende Aufgaben. Ob sie diese auch tatsächlich wahrnehmen, ist nicht relevant.
Günter ist im Haupterwerb CEO eines DE-Unternehmens. Die Unterstellungskoordination folgt den üblichen Regeln gemäss Freizügigkeitsabkommen, sofern Günter EU-Bürger ist. Übt er das Mandat für die Schweiz AG zumindest teilweise in der CH aus, gilt die 25%-Regel. Wenn er also 25% oder mehr seines gesamten Arbeitsvolumens im Wohnsitzstaat ausübt, fällt die Unterstellung nach DE. Die Schweiz AG muss sein Honorar nach DE-Recht mit den DE-Behörden abrechnen. Die Besonderheit dabei ist, dass die Marginalitätsregel nach Art. 14 Abs. 5b VO 987/2009 nicht zur Anwendung kommt. Eine leitende Tätigkeit ist immer relevant und wird bei der Unterstellungskoordination berücksichtigt, selbst wenn Günter nur an einer jährlichen Sitzung in der CH teilnimmt.
Wenn Günter am DE-Unternehmen beteiligt ist, qualifiziert ihn seine Tätigkeit in DE möglicherweise als selbständig. Somit wäre er selbständig erwerbend in DE und unselbständig erwerbend in der CH, denn im Gegensatz zu anderen Ländern qualifiziert ein VR-Mandat nach CH-Recht als unselbständige Tätigkeit. Diesfalls fällt die Unterstellung in die Schweiz – für sämtliche Einkommen aus der CH und der EU (ausser, Günter setzt für das VR-Mandat nie einen Fuss in die Schweiz).
Merke: Ist Günter norwegischer Staatsbürger, ist das Abkommen mit der EU nicht anwendbar. Stattdessen gilt das Länderabkommen zwischen der CH und DE. Hier gilt für leitende Personen das Erwerbsortsprinzip. Das bedeutet: Vergütungen für in DE geleistete Arbeit sind in DE abzurechnen, in der CH geleistete Arbeit in der CH (Unterstellungssplitting). Wohnt Günter nicht in Deutschland, sondern in Mexiko, untersteht die VR-Tätigkeit für die Schweiz AG CH-Recht, unabhängig davon, ob er sich jemals in der Schweiz aufhält. Da es zwischen der Schweiz und Mexiko kein Sozialversicherungsabkommen gibt, gilt nationales Recht in beiden Staaten. Es ist zusätzlich zu prüfen, ob nach mexikanischem Recht lokale Pflichten bestehen.
Fazit
Die grenzüberschreitende Zusammenarbeit bietet Chancen. Sich den Herausforderungen zu verweigern, verwehrt den konformen Zugang zum globalen Arbeitsmarkt. Eine saubere Analyse als Grundlage für eine klare Strategie eröffnet Möglichkeiten bei abgewogenem Verhältnis von Risiko und Aufwand.
Take Aways
- Grenzüberschreitende Beschäftigung verlangt Präzision. Wohnsitz, Arbeitsort und Nationalität beeinflussen die Sozialversicherungsunterstellung.
- Wer dauerhaft im Homeoffice im Ausland arbeitet, ist möglicherweise dem Sozialversicherungsrecht des Wohnsitzstaats unterstellt – inklusive Registrierungspflicht für den Schweizer Arbeitgeber.
- Für eine saubere Unterstellungskoordination sind immer alle Tätigkeiten einer Person zu berücksichtigen und in korrekte Beziehung zu setzen.
- Der Versuch, Mitarbeitende über Selbständigkeit oder externe Dienstleister im Ausland einzusetzen, birgt erhebliche Risiken und kann zu nachträglichen Umqualifikationen oder zu Verstössen gegen gesetzliche Bestimmungen zum Personalverleih führen.
- Verwaltungsratsmandate und Führungspositionen unterliegen besonderen Bestimmungen, nach denen nicht immer die physische Präsenz entscheidet.