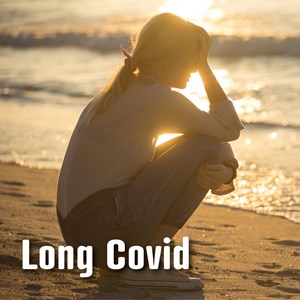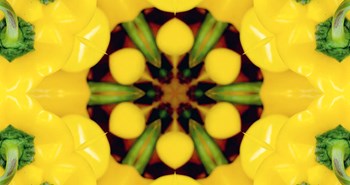Gleichzeitig braucht es strukturelle Anpassungen am Arbeitsplatz. Aufgaben sollten sinnvoll verteilt werden. Ein realistisches Pensum entlastet alle Beteiligten. Personalverantwortliche sollten dabei auch mögliche Zusatzbelastungen im Team im Blick behalten. Wenn eine Rückkehr mit reduziertem Pensum erfolgt, kann das zu Unmut oder Überlastung anderer Teammitglieder führen. Hier hilft es, frühzeitig zu kommunizieren, organisatorische Lösungen zu finden und das Team aktiv einzubinden.
Was sind konkrete Gestaltungsoptionen am Arbeitsplatz?
Die Anpassungen können auf den drei Ebenen Gestaltung der Arbeitszeit, des Arbeitsplatzes sowie der Arbeitsaufgaben erfolgen. Die jeweiligen Möglichkeiten müssen in Zusammenarbeit mit dem Betrieb geprüft werden. In zeitlicher Hinsicht sind flexiblere Arbeitszeiten, flexible Pausenregelungen, keine Schichtarbeit und wenn möglich Homeoffice denkbare Anpassungen. Am Arbeitsplatz sind eine ruhige Umgebung, technische Hilfsmittel wie höhenverstellbare Arbeitsflächen, Eingabehilfe für den Computer, Transport- und Hebehilfen bei körperlichen Belastungen und die Schaffung von Ruhebereichen mögliche Unterstützungen. Wichtig ist zudem die Wahl der Aufgaben. Diese sollten unterbrechbar, möglichst ohne Termindruck und im Umfang dem Pensum angepasst sein. Die Arbeitsinhalte sollten so gestaltet sein, dass die Gefahr einer Überbeanspruchung vermieden wird. Welche der beschriebenen Massnahmen sinnvoll und umsetzbar ist, muss im Einzelfall evaluiert werden.
Wer sollte die betroffene Person im Betrieb begleiten?
Die direkte Führungskraft ist die wichtigste Bezugsperson. Unterstützung durch das HR oder ein betriebliches Gesundheitsmanagement ist sinnvoll. Viele Unternehmen bieten auch die Möglichkeit eines externen Coachings oder Case Managements an. Sie koordinieren die therapeutische Begleitung und wahren die Privatsphäre gegenüber den Arbeitgebenden. Die Verortung der Vertrauenspersonen ausserhalb des Unternehmens erleichtert es Mitarbeitenden häufig, ihre zum Teil sehr privaten Anliegen zu kommunizieren. Zudem kann in Rücksprache mit den Betroffenen und dem medizinischen Setting auch für die Arbeitgebenden Klarheit und Sicherheit in der beruflichen Wiedereingliederung geschaffen werden.
Wie ist die Kooperation mit Versicherungen geregelt?
In schwerwiegenden Fällen beginnen wir mit therapeutischen Arbeitsversuchen. Das sind erste Schritte zurück in den Arbeitsalltag, in denen noch keine produktive Leistung erwartet wird. In dieser Phase ist meist die Krankentaggeldversicherung zuständig. Später übernimmt die IV mit strukturierten Integrationsmassnahmen. Diese greifen jedoch erst, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. Die betroffene Person muss mindestens acht Stunden pro Woche im Aufbau und seit sechs Monaten und weiterhin noch zu mindestens 50 Prozent arbeitsunfähig sein. Zudem dürfen die Massnahmen maximal zwölf Monate dauern. Diese Fristen machen eine enge Abstimmung notwendig. Zudem verläuft eine Reintegration bei Long Covid nicht immer linear. Es kann zu Crashes und Rückschritten bei der Belastbarkeit kommen.
Was sind typische Stolperfallen für Betroffene?
Viele übernehmen zu früh zu viel Verantwortung. Sie wollen nur noch schnell etwas erledigen und überfordern sich dabei. Auch Lärm, soziale Kontakte oder komplexe Aufgaben können unterschätzt werden. Warnsignale werden häufig zu spät erkannt, obgleich die Therapie darauf abzielt, genau diese wahr- und ernst zu nehmen. Daher sind strukturierte Pausen und ein klarer Tagesablauf besonders wichtig. Gleichzeitig besteht die Gefahr, dass Betroffene durch die erlittenen Crashes Ängste und Hemmungen in Bezug auf die Aktivität erleiden und daher dazu wieder ermutigt werden müssen.
Wie hat sich die gesellschaftliche Wahrnehmung von Long Covid entwickelt?
Sie hat sich verbessert. Anfangs war Long Covid schwer zu fassen, da objektive medizinische Marker fehlen. Trotz fehlender Objektivierbarkeit ist die Krankheit heute besser anerkannt. Auch die therapeutischen Angebote sind vielfältiger geworden. Das hilft uns in der Begleitung sehr.
Take Aways
- Fatigue ist keine Erschöpfung, die mit starken Aktivierungsimpulsen therapiert werden kann – sie erfordert ein individuell abgestimmtes Vorgehen, das Überforderung vermeidet (Pacing).
- Eine erfolgreiche Wiedereingliederung setzt strukturelle Anpassungen und eine offene Kommunikation im Unternehmen voraus, vor allem mit dem Team. Diesem sollten keine Zusatzbelastungen aus der Situation erwachsen.
- Führungskräfte sind Schlüsselpersonen in der Begleitung. Externe Coaches und Case Manager können mit ihrem spezifischen Wissen über Sozialversicherungsrecht und therapeutische Optionen eine unterstützende Rolle für Betroffene und Personalverantwortliche einnehmen.
- Versicherungen, insbesondere die IV, haben klare Voraussetzungen und Fristen – ein gutes Zusammenspiel aller Akteure ist unerlässlich.