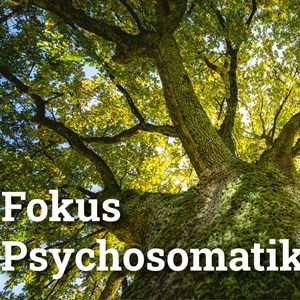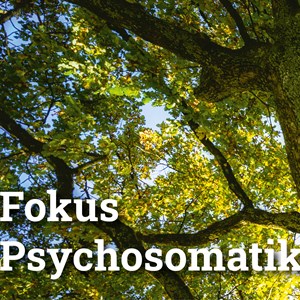Was ist Psychosomatik, Frau März?
Der Mensch ist immer psychosomatisch. Natürlich gibt es die schulmedizinische Einteilung in Soma und Psyche. Aber denken wir einmal an die vielen Sprichwörter, die wir verwenden: Ihm ist eine Laus über die Leber gelaufen; ihr ist die Galle hochgekommen; jenem sitzt ein Frosch im Hals. Oder jemand hat sein Kreuz zu tragen, hat also Rückschmerzen aufgrund von Sorgen und Belastungen. Inzwischen wissen wir, dass tiefere soziale Schichten vermehrt unter Rückenschmerzen leiden, die sich nicht allein durch die Arbeitstätigkeit erklären lassen, sondern auch durch Sorgen oder Konflikte. Auch kennt jeder Prüfungsangst, das Schwitzen oder den Durchfall. Dies sind ganz normale psychosomatische Reaktionen. Die Psyche führt zu Reaktionen im Körper und auch der Körper kann letztlich Reaktionen in der Psyche auslösen.
Welche Erwartungen haben Patienten, die zu Ihnen in die Praxis kommen?
Häufig kommen Patienten, die aufgrund somatischer Störungen wie Herzrhythmusstörungen, Sehstörungen oder diffusem Schwindel schon viele Abklärungen hinter sich haben. Man hat nichts gefunden, und tatsächlich handelt es sich z. B. um einen Erschöpfungszustand, also um Stressreaktionen des Körpers, die diese Symptome auslösen. Ebenfalls psychosomatisch sind psychische Anpassungsprobleme von Menschen, die schwer körperlich erkrankt sind. So kann beispielsweise jemand, der einen Herzinfarkt erlitten hat, depressiv werden oder eine Angststörung entwickeln, die ohne diesen Infarkt nicht aufgetreten wäre. Psychosomatische Wechselwirkungen gibt es permanent. Man kann in der Medizin nicht das eine, den Körper, ohne das andere, die Psyche, behandeln.
Es hat sich ja einiges getan – in vielen Kliniken werden Patienten schon psychologisch begleitet.
Ja, das stimmt schon, aber Psychologen haben keine fundierte medizinische Ausbildung. In der Psychosomatik ist die Schweiz noch «Entwicklungsland». Es gibt hier keinen Facharzttitel für Psychosomatik wie in Deutschland oder Österreich. In der Schweiz sehen sich Psychiater qualifiziert für Psychosomatik. Die beherrschen sie aber eigentlich nicht. Als Psychosomatiker müssen somatischen Befunde interpretiert werden können und das können Psychiater aufgrund ihrer Ausbildung nicht ausreichend: Falls beispielsweise jemand Herzrasen hat, muss ich unterscheiden können, ob es sich um eine Panikattacke oder um ein somatisch-strukturelles Herzproblem handelt. Es gibt auch keine Psychosomatiker als Gutachter in der Schweiz. Insofern hat Psychosomatik hier noch einen niedrigen Stellenwert.
Das merkt man auch an den Patientenzuweisungen. Der Grossteil kommt nicht über Hausarztpraxen, obwohl es dort viele Patienten gibt, die psychosomatisch begleitet werden müssten. Viele ältere Hausärzte, bei denen psychosomatische Aspekte in der Ausbildung noch nicht so präsent waren, halten psychosomatische Probleme für nicht behandelbar – das stimmt nicht. Ich bin erstaunt, wieviele Betroffene selbst im Internet recherchieren und sich eigenständig an Psychosomatikspezialisten wenden, die es in der Schweiz kaum gibt.
Was sind psychosomatische Leiden genau?
Es gibt einen guten Spruch dazu: «Sagt die Seele zum Körper: Geh Du voraus, denn auf mich hört sie ja nicht.» Stress, den ich hier als globalen Begriff verwende – also nicht nur Arbeitsstress oder Zeitdruck, sondern auch emotionale Belastung wie beispielsweise Trauer, Sorgen, Versagensängste –, schlägt sich in körperlichen Reaktionen nieder.
Jeder Mensch hat Schwachpunkte: Der eine neigt zu Magenproblemen, ein anderer hat Herzprobleme oder hin und wieder Migräne. Diese Beschwerden sind nicht gleich psychosomatisch. Wir sind einfach unterschiedlich, so wie manche Menschen früher ihre Haare verlieren oder Falten bekommen und andere später. Aber Stress kann Schwächen verschärfen. Wer also normalerweise einmal im Monat Migräne hat, kann in Stresssituationen jede Woche Migräne haben. Das ist dann der psychosomatische Anteil. Aber nur psychosomatisch bedingt ist die Migräne in der Regel nicht entstanden.
Wie sollte man damit umgehen, wenn man als Führungskraft von Mitarbeitenden häufig gleiche Beschwerden als Krankheitsgrund genannt bekommt?
Arbeitgebende haben auch die Verantwortung, ideale Arbeitsbedingungen zu schaffen und Mitarbeitende zu halten. Häufige Kurzzeitabsenzen sollten schon Fragen aufwerfen, ob es irgendwo eine psychosoziale Stressbelastung oder ein Arbeitsplatzproblem gibt. Sicherlich ist es angebracht, ein Gespräch zu suchen. Die Frage ist nur, wie offen dieses dann geführt werden kann. Ideal wäre es, wenn es eine Vertrauensperson gäbe, die die Betroffenen anspricht. Manche Arbeitgeber schicken Mitarbeitende auch direkt zu mir, um sie bei der Lösung einer Stressproblematik zu unterstützen. Aber es gibt natürlich auch Arbeitsumgebungen, wo es diese Offenheit nicht gibt.
Schwierig wird es, wenn die Arbeitsplatzbedingungen zum Stress führen. Allgemein sehe ich, dass es aufgrund relativ kurzer Kündigungsfristen – also beispielsweise im Vergleich zu Deutschland – in der Schweiz häufig Stress aufgrund der Angst vor Arbeitsplatzverlust gibt. Das kann ein Dauerstress sein. Auch stelle ich seit Jahren zunehmend fest, dass Arbeit quantitativ gemessen und nicht qualitativ bewertet wird. Beispielsweise geht es in administrativen Bereichen um Fallabschlüsse oder im Verkauf um Umsatz. Dadurch kann enormer Druck bei Arbeitnehmenden entstehen. Nicht alle können sich abgrenzen. Wenn dieser Druck dann auch noch durch die Führung verstärkt wird, ist der Weg für eine psychosomatische Erkrankung geebnet.
Haben Sie Empfehlungen zur Gesprächsführung?
Man sollte keinesfalls mit der Tür ins Haus fallen und eine psychische Belastung unterstellen. Wichtig ist es, Fragen zu stellen und Beobachtungen mitzuteilen, beispielsweise: «Mir ist aufgefallen, dass du in letzter Zeit häufiger Absenzen hast. Ich mache mir Gedanken. Gibt es etwas, was dich belastet?» Das wäre ein Türöffner.
Gibt es typische psychosomatische Erkrankungen?
Es gibt bestimmte Kategorisierungen, unter anderen die Somatisierungsstörungen, die wiederum in bestimmte Erscheinungsformen unterteilt sind. Diese Unterteilung ist rein deskriptiv. In der Praxis stellt sich allerdings die Frage nach den Ursachen – also, handelt es sich z. B. um Erschöpfung oder um eine Depression?
Was ist bei der Hypochondrie der Fall?
Hypochonder haben Angst zu erkranken. Der Akzent liegt mehr auf der Krankheit und ihren künftigen Folgen und weniger auf den Beschwerden. Die Betroffenen, die an einer Somatisierungsstörung leiden, zeigen Beschwerden und leiden unter diesen. Umgangssprachlich wird Hypochondrie oft als Begriff für eingebildete Krankheit benutzt. Hypochonder treffe ich in meiner Praxis sehr selten an. Hypersensible schon, diese sind aber keine Hypochonder.
Was sind Ihre Erfahrungen mit Präventionsmassnahmen am Arbeitsplatz? Können Arbeitgebende überhaupt Einfluss nehmen?
Am meisten Einfluss haben Arbeitgebende natürlich auf die Arbeitsbedingungen. Wenn es um das Individuum geht, wird es schwierig mit dem Einfluss. Vieles über Stressvermeidung ist ja bekannt – also Bewegung, gesunde Ernährung, soziale Bindungen, sinnstiftende Tätigkeiten usw. –, wird aber dann doch nicht gelebt. Allerdings liegt dies in der Eigenverantwortung des Einzelnen.
Ich habe etwa vor einigen Jahren für ein grosses Unternehmen einen Kurs «Stressbewältigung durch Achtsamkeit» durchgeführt. In einem solchen Kurs geht es beispielsweise um Entspannung und Meditation oder den Umgang mit schwierigen Gedanken. Das Unternehmen bot diesen Kurs seinen Mitarbeitenden gratis an. Leider stiess er nicht auf grosse Resonanz. Und auch der Austausch innerhalb der Gruppe war schleppend, weil keiner aus sich herausgehen wollte. Es ist in Europa kulturell nicht üblich, sich im Arbeitskollegenkreis «zu outen».
Vertrauenspersonen spielen in der Prävention allgemein und besonders in der Unterstützung von Betroffenen eine wichtige Rolle. Sie müssen nicht unbedingt HR-Fachpersonen sein. Und natürlich sind die Führungskräfte gefragt. Wenn ich in der Praxis Führungskräfte begleitet habe, habe ich oft gehört: «Jetzt verstehe ich die Mitarbeiter viel besser.» Das heisst nicht, dass jede Führungskraft in Therapie sollte. Aber einen achtsamen Umgang mit sich selbst zu lernen, ermöglicht auch einen achtsamen Umgang mit anderen.